Die Shitcoms des Jahres (Teil 2)
Wenn ein Spielfilm es in der ersten Viertelstunde nicht schafft, seine Zuschauer zu überzeugen, ist er tot. Nach einer Viertelstunde hat man sich ein Urteil gebildet; alles, was danach kommt, kann den Gesamteindruck allenfalls noch trüben, verbessern aber nur in den seltensten Fällen. Bei Serien dürfte das ähnlich sein.
„Heading Out“ (BBC2, wie alle hier besprochenen Serien 2013) brauchte keine fünf Minuten, um mich zu verlieren.
In diesen fünf Minuten versuchte eine Tierärztin, erkennbar lesbisch und um die vierzig, ein „Ich bin klug, ein bisschen schüchtern und leicht tollpatschig“-Brille auf der Nase (ja, das kann ich alles aus einer Brille herauslesen), einer Frau um die 50 zu erklären, dass die vor ihr auf dem Untersuchungstisch liegende tote Katze, Achtung: tot war. Nicht mehr lebte. Abgeritten war zu ihren Ahnen. Ja, die alte „Dead Parrot“-Nummer von Monty Python, nur ohne die Witze und ohne Darsteller mit funny bones. In der Variation des Themas, wie es Sue Perkins (Hauptdarstellerin und Autorin) hier probiert, insistiert die Katzenbesitzerin auf allerlei homöpathische Mittelchen, ob man es nicht mal mit Bachblüten probieren könnte etc., während die Tierärztin Sara sich bemüht, möglichst diplomatisch zu vermitteln, dass das Vieh tot ist. Vergeblich, wie man sich denken kann.
Zweite Szene: Im Vorzimmer der Tierarztpraxis, die Katzenbesitzerin ist wutentbrannt abgedampft, muss Sara ihrem Assistenten erklären, welche Formulierungen er besser nicht gebrauchen soll, wenn er mit den Besitzern kürzlich verstorbener Katzen spricht, mit dem Erfolg, dass der Assistent coram publico alle unsensiblen Formulierungen aufsagt und Sara anschließend ein Geburtstagsständchen singt, das auf „happy birthday, she killed a cat“ endet.
Dann habe ich ausgemacht.
Weitergegangen wäre es damit, dass die Veterinärin von ihren Freunden mehr oder weniger gezwungen wird, ihren Eltern offenzulegen, dass sie lesbisch ist, und ich bin froh, dass ich das nicht mehr sehen musste. Denn das wäre gewesen, wie wenn Miranda Hart ihren Eltern hätte sagen müssen, dass sie dick ist. Nur dass Miranda Hart ein Minimum an komischem Talent hat. Mit einem Wort: „Heading Out“ has kicked the bucket, shuffled off its mortal coil, run down the curtain and joined the bleedin‘ choir invisibile! Die BBC hat bereits bestätigt, dass es bei einer Staffel bleiben wird. (Single Camera, kein laugh track)
„Pat & Cabbage“ (ITV) hat es ebenfalls nicht auf meine reguläre Playlist geschafft. Das aber nicht wegen handwerklicher Mängel, sondern weil eine Sitcom über zwei Frauen jenseits der Menopause schon sehr speziell sein müsste, damit ich sie mir regelmäßig ansehe. Das ist „Pat & Cabbage“ nicht. Schlecht aber muss die Serie deshalb nicht sein.
Pat (Barbara Flynn, „Cracker“, hierzulande bekannter als „Für alle Fälle Fitz“) und Cabbage (Cherie Lunghi, „Starlings“) sind verwitwet bzw. geschieden und haben erkennbar kein Interesse daran, in Würde zu altern. Statt dessen verliebt sich die eine ein bisschen in einen Herrn ihres Alters, ist aber zu schüchtern, und die andere versucht, die beiden zusammen zu bringen. Parallel dazu erfahren wir, dass Pats Tochter Helen (Rosie Cavaliero, „Saxondale“, „Spy“) Cabbage für einen schlechten Einfluss auf ihre Mutter hält und am liebsten hätte, dass sich die beiden angehenden Seniorinnen auch wie solche benehmen.
Wie gesagt: Nicht meine Baustelle, aber auch nicht unsympathisch und von den üblichen Scherzen über ökonomische Verwertungsmöglichkeiten rüstiger Rentner weit entfernt, wie sie hierzulande zu Seniorenkomödien offenbar zwingend dazugehören („Sein letzter Lauf“, siehe Stefan Gärtners Sonntagskolumne bei Titanic online). Kein brüllend lauter Humor, alles eher gentle, aber das ist bei der Zielgruppe wohl selbsterklärend. (Single Camera, kein laugh track)
„The Wright Way“ (BBC1) macht es einem leicht: Worst. Sitcom. Ever.
Die erste Zusammenarbeit von Ben Elton („We Will Rock You“) und David Haig seit „The Thin Blue Line“ (BBC, 1995 – 96) ist von der ersten Sekunde an alt. Ich würde „altmodisch“ sagen, aber das verwende ich hin und wieder auch in einem positiven Zusammenhang, und an „The Wright Way“ ist nichts positiv.
David Haig ist Gerald Wright, ein Health-and-Safety-Inspektor, der sich für vernünftig und alle Welt für verrückt geworden hält. Eine Fleischwerdung des „gesunden Menschenverstands“ also, ein Reaktionär — aber einer, dem wir als Zuschauer immer zustimmen sollen: Ist es nicht wirklich verrückt, wie das so ist in unserer heutigen Welt mit (hier bitte eigene Vorurteile gegen das modern life einfügen)?
Der ungelogen erste Dialog geht so:
GERALD
(hämmert gegen die verschlossene Badezimmertür) Victoria, are you gonna be long in there? It’s just I’m late for work. (geht in die Küche. Zu seiner Tochter) Victoria won’t get out off the bathroom.SUE
She will do, Dad, when she’s finnished.GERALD
She’s female, Susan, she’s in a bathroom. She’s never going to be finished.
Mwahaha!! (Und ja, hier gibt es einen laugh track, trotz der single camera, der noch unterstreicht, wie wenig man selbst lachen muss.) Noch lustiger wird’s natürlich, wenn man weiß, dass Victoria die Partnerin seiner Tochter ist, nicht etwa seine Frau. Nein, diese Lesben!
„I would surley die if I watched more than five minutes“, gibt ein Kritiker vom Spectator zu, und ich bin auch tatsächlich fast gestorben vor Ekel und Fassungslosigkeit: Gags, die man kaum als solche bezeichnen kann, Rechthaberei, die auf zustimmendes Lachen spekuliert, grauenhaft ausgearbeitete Charaktere — daran ist wirklich alles falsch.
Offenbar hat die BBC das auch noch vor der Ausstrahlung bemerkt und die Show dienstags um halb elf Uhr nachts gezeigt, so dass kaum jemand sie gefunden hat, und sie dann direkt nach der Ausstrahlung abgesetzt.
Viel ist schon geschimpft worden auf Ben Elton, der sich in den achtziger Jahren mal glühende Fans gemacht hat mit „The Young Ones“ (BBC2, 1982 – 84) und „Blackadder“ (BBC1, 1983 – 89). Damals war er Vorreiter der alternative comedy-Bewegung, der auch als Stand Up Comedian („The Man From Auntie“, BBC1, 1990 – 94) gerne aneckte. Seitdem er sich allerdings auf Musicals verlegt hat („We Will Rock You“ und „Love Never Dies“, das Sequel zum „Phantom der Oper“, Grundgütiger) werfen ihm alte Fans Ausverkauf vor. Ja, mehr als das: mit „We Will Rock You“-Aufführungen in Südafrika hat Elton zumindest stillschweigend akzeptiert, dass das Embargo gegen das Apartheitsregime gebrochen wurde — was mit seinen linken Positionen von früher nur schwer zu vereinbaren war.
Aber all das würde ich ihm nicht vorwerfen, wenn er immer noch komische Sitcoms schriebe. Tut er aber leider nicht — schon „The Thin Blue Line“ war schwach, „Blessed“ (BBC1, 2005) mit Ardal O’Hanlon in der Hauptrolle sogar mitleiderregend fad, und seine Variety-Show „Ben Elton Live From Planet Earth“ (Nine Network, Australien) wurde 2011 nach drei Folgen eingestellt, obwohl sechs bestellt waren.
Mit „The Wright Way“ ist Ben Elton ganz, ganz unten angekommen. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. NOT.
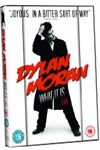
Neueste Kommentare