Gute Witze, schlechte Witze
Seit ich (bewusst) fernsehe, gibt es amerikanische Sitcoms, bei denen ich immer mal wieder beim Durchzappen hängen geblieben bin; einige davon habe ich irgendwann regelmäßig geguckt; zwei davon habe ich irgendwann komplett auf DVD erworben und auch noch einmal von A bis Z geguckt: „Seinfeld“ (NBC, 1989 – ’98, deutsche Erstausstrahlung 1995 auf ProSieben) und „Frasier“ (NBC, 1993 – 2004, dt. Ea. 1995 auf Kabel eins). Jetzt, nachdem das Box Set in Großbritannien auf erschwingliches Niveau gefallen ist, ist „Cheers“ dran (NBC 1982 – ’93, dt. Ea. 1985 im ZDF).
Klar, nach „Cheers“ kamen US-Sitcoms, die mich mehr geprägt haben: „Married … with Children“ (Fox, 1987 – ’97, dt. Ea. 1992 auf RTL als „Eine schrecklich nette Familie“) und „Frasier“, weniger schon wieder „Friends“ (NBC, 1994 – 2004, dt. Ea. 1996 auf Sat.1). Heute bleibe ich hin und wieder bei „The Big Bang Theory“ (CBS, seit 2007, dt. Ea. 2009, ProSieben) und „How I Met Your Mother“ (CBS, 2004 – ’15, dt. Ea. 2008, ProSieben) hängen, aber erwerben und von Anfang an gucken würde ich sie nicht. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit.
Alle diese Sitcoms hatten drei Gemeinsamkeiten:
– Sie liefen sehr lange und hatten viele Folgen pro Staffel (i.d.R. über 20), so dass sie schon allein qua Menge praktisch täglich liefen und laufen, oft sogar mehrere Folgen am Tag. Man konnte ihnen gar nicht entkommen. Schon gar nicht früher, als es noch nicht so viele Sender gab.
– Sie waren praktisch statisch, d.h. es kamen zwar über die Staffeln hinweg Figuren dazu und andere Figuren verließen die Show, aber abgeschlossene Handlungsbögen (wie sie bei britischen Sitcoms mit ihren sechs Folgen pro Season die Regel sind) gab es praktisch nicht. Dass mal eine Figur eine andere heiratete (Niles etwa Daphne) war schon ein Höhepunkt und auf lange Sicht auch schon einigermaßen knifflig, weil es das Beziehungsgefüge der Figuren ja nicht unwesentlich veränderte. Die Frage will they, won’t they war damit nämlich beantwortet.
– Sie waren alle live vor Publikum aufgezeichnet.
Als ich gestern nun die ersten drei Folgen „Cheers“ zum ersten Mal in dieser Reihenfolge gesehen habe (womöglich auch tatsächlich zum ersten Mal, jedenfalls konnte ich mich nicht daran erinnern, wie Diana überhaupt zum Bar-Team gestoßen ist), war ich überrascht: überrascht, wie gut „Cheers“ gealtert ist. Denn 1982 war ich zehn, die Fernsehstandards haben sich seitdem stark geändert, und ich wüsste auf Anhieb weder eine deutsche noch eine englische Sitcom aus dieser Zeit, die heute noch den Test der Zeit so gut bestünde.
Aber „Cheers“ funktioniert wie ein Uhrwerk: Diana (Shelley Long) kommt in der Pilotfolge als die neue Figur in ein schon bestehendes Setting (das der Bar), und zwar auf eine Weise, die ihre spannungsgeladene Beziehung zu Sam (Ted Danson) klärt: sie, Studentin der Boston University, ist mit ihrem Verlobten, dem Professor Sumner Sloan auf dem Weg zur Hochzeit und in die Flitterwochen. Er will nur noch den Ehering von seiner zukünftigen Exfrau holen, Diana wartet so lange im Cheers. Und wartet. Und wartet. Und lässt sich so lange von Sam aufziehen, der als ehemaliger Jock, als gutaussehender (und dem Vorurteil nach dümmlicher) Sportler das Gegenteil von dem ist, was Diana als männliches Ideal vorschwebt. Während umgekehrt natürlich auch sie als halbintellektuelle Oberschichtsangehörige überhaupt nicht in sein Beuteschema passt.
Während Diana also auf ihre Verlobten wartet (der selbstverständlich nicht zurückkehrt), wird uns das restliche Personal vorgestellt: Coach (Nicholas Colasanto) als seniler Alter, der für irrlichternd-abseitige Witze zuständig ist, Carla (Rhea Perlman) als verbitterte Kellnerin, dere Gebiet die schneidend-treffende Punchline ist, sowie die Stammgäste Norm (George Wendt) und Cliff (John Ratzenberger), die das tun, was Bargäste tun: saufen und Quatsch reden („Bier? Ja, davon habe ich gehört“).
Die Dialoge aber sind so schnell und mit guten, nacherzählbaren Pointen gestrickt, dass ich kaum mit dem Mitschreiben nachgekommen bin: visuelle Scherze, Dialogscherze, schnell reingestreute Gags (das Telefon klingelt. Carla: „Who’s not here?“ alle Gäste: „Me!“) — alle Witze zeitlos (also ohne Anspielungen ewta auf zeitgenössische Promis oder Themen), immer in charakter (also nicht nur komisch, sondern auch die Figur beschreibend, die den Gag liefert) und selten der erwartbarste Witz, sondern meistens ein besserer. Wenn es aber der Witz war, den ich habe kommen sehen, dann war er immerhin viel schöner ausgeführt, als ich es erwartet hätte.
Aber das sind halt die Vorteile, wenn man erfahrene Produzenten (in diesem Falle James Burrows, Glen Charles und Les Charles) und Autoren hat (u.a. Ken Levine und Earl Pomerantz), die in der Lage sind, so gute Witze gut in Szene zu setzen, dass ein Live-Publikum sich wegschmeißt vor Lachen.
Und dann habe ich „Welcome to Sweden“ gesehen (NBC, 2014).
Gut, das hätte ich nicht, wenn nicht Amy Poehler („Parks and Recreations“) als Produzentin hinter dieser Show steckte, in der ihr Bruder Greg Poehler die Haupt- und sie selbst eine Nebenrolle spielt. Wie auch Aubrey Plaza (dito „Parks and Rec“), Will Ferrell, Gene Simmons von Kiss, Patrick Duffy und andere Prominente.
„Welcome to Sweden“ ist eine mit nur einer Kamera gefilmte Sitcom (das immerhin im schönen Schweden), also ohne Publikum. Und das ist auch besser so, denn viel zu lachen hätte da auch niemand. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass das die Anforderung an jede Comedy ist; Louis CK etwa schafft ja auch (oft) gute Sitcomfolgen, die ohne große Lacher auskommen.
Aber „Welcome to Sweden“ behauptet, komisch zu sein. Stattdessen liefert die Show über US-Expat Bruce (Poehler), der mit seiner schwedischen Frau Emma (Josephine Bornebusch) in ihre Heimat zieht, dann allerdings nur konventionelle Peinlichkeitsscherze, die ohne große Pointen auskommen — wenn sich etwa Emma mit einer Freundin auf Schwedisch über eine sterbende gemeinsame Bekannte unterhält und Bruce dazwischenkaspert, indem er sich über die schwedische Sprache lustig macht. Oder komisch gemeinte Figuren wie Emmas Slacker-Bruder Gustaf, der aber über diese eine Eigenschaft großer Faulheit hinaus völlig flach bleibt.
Ich habe so eine Ahnung, dass „Welcome to Sweden“ in dreißig Jahren nicht mehr so gut funktioniert wie „Cheers“ heute. Aber das ist nur so eine Ahnung. Als Kontrastmittel zu einer klassischen Sitcom hätte es aber kaum ein besseres geben können.
Und „Welcome to Sweden“ hat so (unfreiwillig und eher zufällig) meine These untermauert, dass es kein Zufall ist, dass die großen Sitcoms, die, mit denen wir auf- und die uns ans Herz wachsen, alle live vor Publikum gedreht sind. Schon weil ein Livepublikum der beste Test dafür ist, wie komisch eine Sitcom tatsächlich ist.
„Cheers“ ist komisch, nach dreißig Jahren immer noch. „Welcome to Sweden“ nicht.
Ich werde über die nächsten Wochen nach und nach die 42 DVDs durcharbeiten, die der Ziegel von einer Komplettbox „Cheers“ hat, oder es jedenfalls versuchen, und darüber bloggen. Wenn es etwas Bloggenswertes gibt jedenfalls.
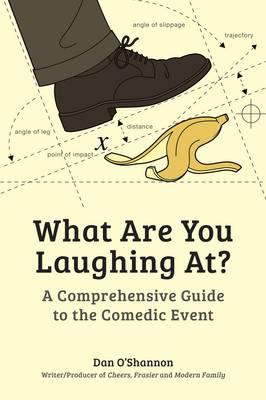

Neueste Kommentare